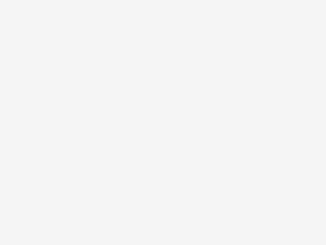Mira Minkara zeigt Gästen ihre Heimatstadt im Norden des Libanons. Die liberale, kosmopolitische Frau hat sich mit der konservativen Gesellschaft arrangiert.
Von Mounia Meiborg
Alte Männer, die zwischen Orangenbäumen ein Schwätzchen halten. Kaffeeverkäufer, die mit klappernden Tassen durch die Gassen laufen. Solch friedliche Dinge sieht, wer an einem sonnigen Tag in Tripoli aus dem Bus steigt. Dazu eine Stadtführerin, die hier auffällt: “Willkommen in dieser verrückten Stadt!”, ruft Mira Minkara.
Klein und zierlich ist sie, trägt eine knallrote enge Jacke zu verschnörkelten goldenen Ohrringen. Ein Paradiesvogel in einer sehr traditionellen Stadt – nur dass es ihre Heimat ist, und sie so etwas wie deren inoffizielle Außenministerin. Seit knapp drei Jahren führt Minkara Libanesen und Ausländer durch die nordlibanesische Stadt Tripoli. Bis 2014bekämpften sich hier alevitische Assad-Unterstützer und sunnitische Assad-Gegner. Doch nun ist die Lage ruhig, junge Männer, die sich vorher beschossen haben, arbeiten nun sogar unter Vermittlung einer NGO zusammen, um die beschädigten Häuser zu renovieren. Das Auswärtige Amt warnt dennoch vor Reisen in den Bezirk Tripoli.
“In Tripoli und in ganz Libanon geht es immer um Zonen. Es gibt eine Zone, in der du nicht sein solltest. Und zwei Straßen weiter ist alles in Ordnung”, sagt Minkara. Sie steht am Eingang des Souks und begrüßt die Gruppe: junge Expats, die in Beirut leben, ein paar Ägypter, Franzosen und Deutsche, die in Libanon Urlaub machen. Und Libanesen, die noch nie in Tripoli waren. Das kleine Land ist eben in jene unsichtbare Zonen geteilt, die entlang der Religionsgrenzen verlaufen. In Tripoli leben vor allem sunnitische Muslime. So mancher Christ aus dem 80 Kilometer entfernten Beirut traut sich hier nicht her.
Die Altstadt will uns Minkara heute zeigen, denn die ist einmalig: Orientalischer als jede andere Stadt in Libanon und vom Krieg weitgehend verschont geblieben. Manche Gebäude sind kunstvoll mit schwarzem und weißem Stein verziert: die Architektur der Mamelucken, einer islamischen Dynastie, die vom 13. bis zum 16. Jahrhundert auch in Tripoli herrschte. Nach Kairo findet sich in der libanesischen Stadt das weltweit größte Erbe mameluckischer Architektur. Die Stadt wurde zur Abwehr von Angriffen labyrinthisch gebaut. Die Gassen mit den Koranschulen, Hamams und Khanen – Karawansereien – sind eng. Und die Torbögen so niedrig, dass man fast den Kopf einziehen muss.
Mira Minkara verschwindet durch eine unscheinbare Tür in einen dunklen Gang. Er mündet in einen Raum mit einer großen Kuppel. Es riecht nach Lehm. Putz blättert von den Wänden, darunter sind Farben zu sehen. Es ist das Hamam al-Nuri, erbaut 1336. Hier, im Vorraum, haben sich die Besucher einst umgezogen und bei einem Glas Tee ausgeruht. Jahrhundertelang war das Hamam in Betrieb – bis 1975 der libanesische Bürgerkrieg ausbrach. Seitdem verfällt es.
“Setzt euch zu mir”, sagt Mira Minkara und erzählt Geschichten: von Männern, die im Hamam Neuigkeiten über den Goldpreis und über Politik austauschten. Und von Frauen, die im Hamam Bräute für ihre Söhne suchten. “Was ist besser als eine halb nackte Frau, die man von oben bis unten abscannen kann?”, sagt Minkara. Heute beschwere man sich über den Schönheitswahn. “Aber Gott sei Dank müssen wir nicht mehr die Tests im Hamam über uns ergehen lassen.”
Als Kind hat Minkara einige Jahre in Dubai gelebt; sie ging dort auf eine internationale Schule. “Wenn du im Ausland aufwächst, gibt es nicht das eine gültige Regelkorsett. Deshalb bin ich vielleicht nicht so konform. Manchmal fühle sie sich mit Ausländern wohler als mit Libanesen. Aber ich respektiere, was ich respektieren sollte.” Auch heute, mit 37 Jahren, ist sie nicht bereit, sich den Normen ganz anzupassen. Sie ist gläubige Muslimin. Und läuft im Sommer im Tanktop durch die Altstadt.
“Merkt ihr, wie ruhig es ist?”, fragt Minkara. Vom Souk, der vor der Tür liegt, ist fast nichts zu hören. “Die Mamelucken waren kluge Stadtplaner. Ganz anders als heute in Libanon.” Mira Minkara hat ihre Abschlussarbeit an der Uni über Tripolis’ Bäder geschrieben. Damals hatte sie viele Ideen, wie man sie restaurieren und in Museen oder Restaurants umwandeln könne. Inzwischen sei sie erwachsen geworden, sagt sie. “Manchmal fragen mich Gäste: Wann wird dieses Hamam restauriert? Ich sage ihnen: Es gibt kein Geld, um das Elektrizitätsproblem zu lösen oder die Müllkrise. Glaubst du wirklich, dass die Regierung Geld für die Restaurierung eines Hamams ausgibt?” Sie sei nicht mehr besonders traurig darüber. “Ich bin trauriger, wenn ich eine Frau auf der Straße betteln sehe.”
Es ist ruhig, seit die Armee die Kontrolle übernahm. Touristen sind trotzdem eine Sensation
Tripoli ist arm. Vor der Moschee sitzen vollverschleierte Frauen und bitten um Kleingeld. Auf einem Markt werden gebrauchte Kleider aus Europa verkauft. Von der Regierung wird Tripoli, die zweitgrößte Stadt des Landes, seit Jahren vernachlässigt. Fast 30Prozent der Menschen leben unter der Armutsgrenze. Vom Hafen legt zweimal in der Woche eine Fähre in die Türkei ab. In letzter Zeit sind nicht nur Syrer an Bord, sondern auch verzweifelte Libanesen. Sie wollen nach Europa.
Am Stadtrand, zu Fuß fünfzehn Minuten vom Zentrum entfernt, grenzt das sunnitische Viertel Bab al-Tabbaneh an das alevitische Viertel Jabal Mohsen. Als 2011 der Bürgerkrieg in Syrien ausbrach, begannen hier Kämpfe. Junge Männer, die vormals Nachbarn und Freunde gewesen waren, schossen aufeinander. Im März 2014 übernahm die libanesische Armee die Kontrolle. Seitdem ist es ruhig. Touristen sind in Tripoli noch immer eine kleine Attraktion. Tripolitaner sind in Libanon für ihre herzliche Art bekannt. Fragt man nach dem Weg, wird man nicht selten zum Ziel begleitet. Kommt gerade kein Taxi vorbei, wird jemand gerufen, der einen hinfährt.
Mira Minkara bewegt sich mit festem Schritt durch die Gassen; scherzt hier mit einem Händler, erkundigt sich dort nach der Familie. Anders als viele Libanesen aus der Mittelschicht ist sie stolz auf ihre arabischen Wurzeln. Intensiv hat sie sich mit der Geschichte ihrer Vorfahren beschäftigt. Nach dem Tourismus-Studium hat sie für eine große Galerie in Beirut gearbeitet. Ausländische Künstler baten sie um eine Führung durch Tripoli. Die Tour war ein Erfolg. Mittlerweile arbeitet sie ausschließlich als Stadt- und Reiseführerin.
Vor der Moschee wird sie streng. “Wahhabitischer Style, nicht iranischer Style!”, sagt sie und zupft einer Französin das Kopftuch so zurecht, dass kein Haaransatz mehr zu sehen ist. Aber sie besteht darauf, die Moscheen mit Touristen zu besuchen. Von einem Imam, der ihr das mal verbieten wollte, hat sie sich nicht abbringen lassen. Mira Minkara verbindet die große Geschichte stets mit den kleinen Geschichten. Sie erzählt, wie sie als Kind mit christlichen Freunden Weihnachten gefeiert hat. Und wie ergriffen sie oft ist, wenn sie eine Kirche betritt. Den schlechten Ruf Tripolis will sie zurechtrücken – damit die vielen unsichtbaren Grenzen ihres Landes etwas durchlässiger werden.